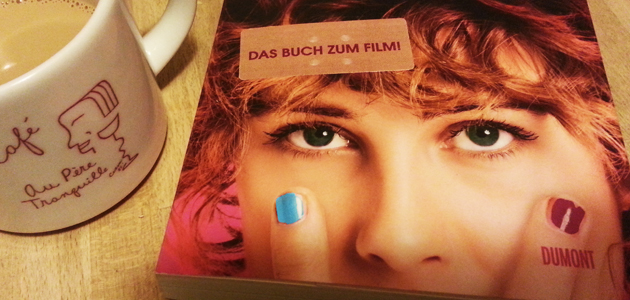 Der Skandalroman von Charlotte Roche wurde 3 Millionen mal verkauft – und im kirchlichen Umfeld erfolgreich ignoriert. Was viele Menschen berührt, scheint grundsätzlich uninteressant. Dabei werden in „Feuchtgebiete“ ur-biblische Werte verhandelt.
Der Skandalroman von Charlotte Roche wurde 3 Millionen mal verkauft – und im kirchlichen Umfeld erfolgreich ignoriert. Was viele Menschen berührt, scheint grundsätzlich uninteressant. Dabei werden in „Feuchtgebiete“ ur-biblische Werte verhandelt.
Feucht wurden eigentlich nur die Augen – vor Lachen. Das skandalumwitterte Buch von Charlotte Roche widerspricht allen meinen Vorurteilen und Befürchtungen. Es erweist sich auf der Höhe der Zeitfragen. Es wäre prädestiniert für kirchliche Bildung.
Zugegeben: Als guter Katholik hätte ich das Buch natürlich nie gelesen – ehrlich! Ich hätte mich nach aussen dem üblichen, leicht verächtlichen „so etwas lese ich doch nicht“ der kirchlichen Gesellschaft angeschlossen. Aber ich habe es leider in einem Wettbewerb gewonnen – wirklich!
Von A-Z überrascht
Also hab ich es gelesen. Und war von A-Z überrascht. Erst mal darüber: wer das Buch alles gelesen hat, wenn mensch mal damit rausrückte: Unglaublich. Aber klar, irgendwo müssen die drei Millionen verkauften Exemplare ja gelandet sein. Also hat Charlotte Roche etwas angesprochen, das die Menschen berührt. Und das alleine wäre natürlich ein Grund, sich eingehender damit zu befassen. Kirchlicherseits, meine ich jetzt. Aber zum Glück gibt’s ja den Konjunktiv. Einfacher ist es, um die eigenen Fragen zu kreisen als um die, welche die Menschen berühren. Oder eben zum Thema “Zeitfragen” Karl May als Lesezirkel anbieten…
Ein Kammerspiel
Zurück zum Buch selber. Auch da: Überraschung! Das ist ja gar nicht erotisch! Nein. Also keine Angst, es befeuert nicht unschickliche Phantasien – jedenfalls bei mir nicht.
Eigentlich ist es ein Spitalroman. Ein Kammerspiel. Das ganze Buch spielt in einem Krankenzimmer. Und die eigentliche Krankheit der Hauptdarstellerin Helen Memel ist die Trennung ihrer Eltern. Und dass sie den missglückten Versuch ihrer Mutter miterlebte, sich selber und Helens Bruder mit Gas zu töten.
Im Spitalzimmer überwindet sie schmerzlich ihre Wiedervereinigungsphantasien und versöhnt sich mit ihrer Geschichte. Nur deshalb kommt sie am Schluss mit einem Spitalpfleger zusammen. Ende gut, alles gut.
Heilung “passiert”
So gesehen eine banale „Coming of Age“-Story. Die kalte Mutter, der böse Arzt, der gute Pfleger. Alles da.
Aber die menschliche Geschichte läuft unter der Oberfläche mit. Und Helen erlebt sie selber auch so. So wie die meisten Menschen ihre Lebensgeschichte zumeist einfach so erleben.
Ihre Heilung „passiert“ Helen einfach unter der Oberfläche, während ihr Bewusstsein sich ganz mit dem sichtbaren Teil des Eisberges ihrer Persönlichkeit auseinandersetzt.
Tabus in lakonischem Blog-Stil
Die Spitze des Eisbergs ist hier das, was normalerweise tunlichst verdeckt wird. Das kehrt Roche bzw. Helen Memel ganz nach aussen. Im Blog-Stil, lakonisch, voller Selbstironie erzählt sie über ihren Körper und die Stellen, die sonst tabu sind. Ausschlag am Hintern, die einzelnen Teile ihres Geschlechtsorgans. Sie beschreibt es so wie Finger, Augenfarbe oder Haare.
Als Körperteile eben. Zwar ist klar: das ist die psychische Reaktion auf ihre gestörte Mutter. Aber es ist eben auch mehr. Sie gibt dem Körper als Ganzes seine Natürlichkeit zurück. Da gibt’s keine „dreckigen“ Stellen mehr. Wimperntusche oder Intimrasur, beides liegt auf der selben Ebene.
Weder peinlich noch pornographisch
Und sie tut dies auf eine Art, die weder peinlich noch pornographisch ist, sondern in ihrer Lakonie schlicht natürlich und auf eine ganz eigene Weise unschuldig und „rein“.
Ein Pickel im Gesicht oder zwischen den Po-Backen – wo ist der Unterschied?
Und genau so erzählt Helen auch von ihrem Sex-Leben. So wie jemand anders vom Briefmarkensammeln oder vom Ballet oder vom Fussball erzählt. Mit Interesse, mit Begeisterung, mit Humor – und auch hier mit lakonischer Selbstironie.
Wenn Helen von ihrem Körper erzählt, habe ich als Leser immer die Möglichkeit, selber die Distanz festzulegen. Dank ihrer bildhaften Sprache und ihrem humorvollen Stil kann ich so viel „Anschauung“ zulassen, wie ich möchte, und sonst dem lockeren Textfluss folgen.
Ein Stück Unschuld zurückgeben
So schafft es Roche, dass ihre Beschreibungen nie abstossend oder pornographisch wirken. Das muss man erst mal schaffen, bei den Phantasien, die in unserer Welt – tja, eben ein Tabu sind und nur in sorgsam verborgenen Hirnregionen vieler Menschen existieren.
Darin liegt die Leistung von Roche. Sie gibt dem Körper mit „Feuchtgebiete“ ein Stück Unschuld zurück. Im Kopf wissen wir Aufgeklärten das ja schon lange, nur im Alltag ist das immer noch praktisch unmöglich.
Roche führt afu diese Weise vor, wie verklemmt unsere „aufgeklärte“ Welt weiterhin ist, und dass die behauptete „Übersexualisierung“ des Alltags eben blosse Behauptung ist bzw oberflächliche Fassade.
Eden im Krankenzimmer
Roche hält uns den Spiegel vor. Nicht auf die besserwisserische, lehrerhafte, moralische Tour, sondern indem sie einfach lustvoll eine Geschichte erzählt. Damit zeigt sie, wie man auch noch über seinen Körper reden könnte, und dass das funktioniert, ohne sich dafür schämen zu müssen
Die Bibel schreibt, dass der ganze Körper Gottes Geschöpf ist. Und dass Eden dort ist, wo mensch sich nicht seines Körpers schämen muss.
Charlotte Roches alter Ego Helen Memel lebt so gesehen sehr nahe an den biblischen Idealen.


